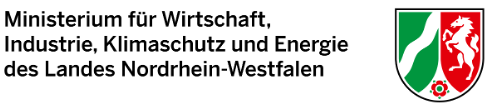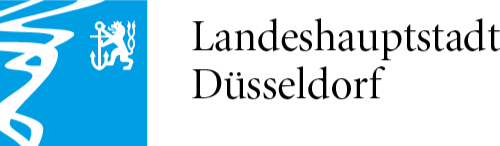Fachartikel
1stMOVER initiiert neuen DefenseTech-Inkubator.NRW
Ausgangssituation in Deutschland und NRW
Das DefenseTech-Innovation-Ökosystem in Deutschland leidet unter tief verwurzelten strukturellen und kulturellen Herausforderungen, die die Entwicklung und Skalierung neuer Technologien erheblich hemmen. Jahrzehntelange geopolitische Stabilität, eine Kultur des Pazifismus und ein starkes Sicherheitsgefühl haben dazu geführt, dass die Notwendigkeit von Innovationen im Verteidigungsbereich weitgehend unterschätzt wurde. DefenseTech wird oft skeptisch betrachtet, was sich in einer abgeschotteten Industrie, einer mangelnden Öffnung für externe Innovationen und einer langen Zurückhaltung des Venture-Capital-Markts zeigt.
Hochschulen, als potenzielle Quellen von Breakthrough-Innovationen, haben bisher kaum DefenseTech als Forschungsschwerpunkt etabliert, was sowohl zu einer unzureichenden Sensibilisierung für das Potenzial von Forschungsergebnissen als auch zu einer äußerst geringen Anzahl von Startups und Spin-offs geführt hat. Gleichzeitig fehlen staatliche Fördermechanismen, wie sie in anderen Ländern existieren, um gezielt DefenseTech-Gründungen zu unterstützen und eine Brücke zwischen Forschung, Industrie und staatlichen Bedarfsträgern zu schlagen.
Aktuelle Schätzungen belaufen sich auf etwa 100 aktive DefenseTech-Startups in Deutschland, eine sehr geringe Zahl bezogen auf die deutsche Startup- & Hochschulwelt insgesamt, wobei die genaue Zahl durch Definitionsfragen und Intransparenz im Sektor schwierig zu ermitteln ist. Das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) identifizierte in seinem Technologieradar 178 Unternehmen, die militärische Anwendungen entwickeln, wobei aber nur 43% dieser Firmen jünger als zehn Jahre sind. Diese Zahlen umfassen nämlich auch etablierte Mittelständler, sodass der reine Startup-Bereich auf etwa 100 Unternehmen geschätzt wird. Nordrhein-Westfalen liegt mit nur ca. 10 aktiven DefenseTech-Startups und Hochschul-Spin-offs weit hinter Bayern (ca. 35) und Baden-Württemberg (ca. 30). Beispiele sind:
- CyberCompare (Köln):
Plattform für Cyberwarfare-Simulationen, genutzt im NATO-CCDCOE. - Fraunhofer FKIE (Wachtberg):
Spin-off des Fraunhofer-Instituts für KI-gestützte Lagebildanalyse. - Code Intelligence GmbH (Bonn):
Automatisierte Schwachstellenerkennung für Embedded Systems - SmartSensor Labs (Dortmund):
Entwickler von CBRN-Erkennungssystemen (chemisch, biologisch, radiologisch, nuklear) - AeroNRW (Köln):
Drohnenplattformen für zivile/militärische Luftaufklärung - NeuroDefense (Aachen):
KI-gestützte Auswertung von Satellitenbildern zur Geländeanalyse
- SecureGrid (Essen):
Quantum-Key-Distribution-Netzwerke für abhörsichere Kommunikation - FibreCoat (Aachen):
stellt beschichtete Hochleistungsfasern her, z. B. metallbeschichtete Basaltfasern für elektromagnetische Abschirmung auch im militärischen Kontext. - SKIDER (Dortmund):
entwickelt ein System zur herstellerübergreifenden Steuerung und Vernetzung von Drohnen, inklusive sicherer Kommunikation und Koordination von Swarm-Drohnen. - Infiniteq (Mülheim):
arbeitet an vernetzten, autonomen Drohnensystemen (Luft, Wasser, Land) mit umfassender Sicherheitsarchitektur.
- ASDRO (Essen):
arbeitet mit autonomen Drohnen + geophysikalischen Sensoren zur präzisen Vermessung von Oberflächen und Untergründen in schwer zugänglichen oder sicherheitskritischen Bereichen. - Auxsys (Aachen):
entwickelt aktive Ganzkörper-Exoskelette zur Lastenentlastung bei körperlich belastenden Einsätzen mit Fokus auf militärischen Anwendungen - staltec (Meerbusch):
bietet fortschrittliche Oberflächentechnologien, Beschichtungen und reparationstechnische Services, z.B. auch für Verschleiß- und Korrosionsschutz kritischer Komponenten militärischer Systeme.
Ein DefenseTech-Inkubator für NRW kann ein DefenseTech-Innovation-Ökosystem schaffen, das Hochschulen, Startups, Industrie und öffentliche Stellen vernetzt, die Produktisierung und Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen fördert und dringend benötigtes Kapital vermittelt sowie strategische Beratung bereitstellt. Dieses Vorhaben kann nicht nur die technologische Innovationskraft von NRW stärken, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur strategischen Autonomie Deutschland und Europas leisten.
Dual-Use- und DefenseTech-Potenziale in NRW
Nordrhein-Westfalen (NRW) bietet mit seiner vielfältigen Wirtschaftsstruktur, exzellenten Forschungslandschaft und zentralen Lage in Europa eine solide Grundlage, um ein leistungsfähiges DefenseTech-Ökosystem zu entwickeln. DefenseTech umfasst Technologien mit militärischer und ziviler Anwendung (Dual Use) – darunter KI, autonome Systeme, Sensorik, Quanten- und Cybersicherheitstechnologien. Vor dem Hintergrund sicherheitspolitischer Veränderungen („Zeitenwende“) und wachsender Verteidigungsbudgets eröffnen sich neue Chancen für Startups, Forschung und Unternehmen in NRW.

NRW verfügt bereits heute über eine Vielzahl von Akteuren, die an sicherheitsrelevanten Technologien arbeiten – teils mit explizitem Defense-Bezug, teils mit Dual-Use-Potenzial:
- Künstliche Intelligenz (KI):
Forschungseinrichtungen wie das Lamarr-Institut (Bonn/Dortmund), KI.NRW und Fraunhofer IAIS arbeiten an Technologien zur automatisierten Auswertung von Daten, Lagebildern und Bedrohungsanalysen. Startups wie TrueOcean oder CollectAI entwickeln KI-Lösungen, die sich für Aufklärung, Datenfusion oder Social-Media-Überwachung adaptieren lassen. - Drohnen & UAVs:
Die Firma ASDRO (Essen) hat eine mit der Bundeswehr getestete Drohne zur Minendetektion entwickelt. Third Element Aviation (Bielefeld) bietet robuste Multicopter-Plattformen für autonome Logistik an – mit Potenzial für militärischen Nachschub und Aufklärung. - Robotik & Autonome Systeme:
Die Uni Bonn (AIS Group, Team NimbRo) ist führend in Telepräsenz-Robotik. Forschungsprojekte an der RWTH Aachen und FHs entwickeln autonome Fahrzeuge, die sich auch für militärische Logistik und Sensorträger eignen. - Sensorik & ISR:
Die Fraunhofer-Institute FKIE, FHR und INT erforschen Radarsysteme, multisensorische Datenfusion und elektromagnetische Abschirmung – essenziell für Lageerfassung, Drohnenerkennung und Schutz kritischer Infrastruktur. - Industrial IoT (IIoT):
Die PHYSEC GmbH (Bochum) entwickelt Manipulationsschutz für Sensoren und Netzwerke. Zahlreiche Industrieunternehmen in NRW (z. B. Turck, ifm) produzieren Sensorik und Automatisierungstechnik, die sich für militärische Anwendungen eignen. - VR/AR & Simulation:
Hochschulen in Bonn, Essen und weitere Einrichtungen forschen an immersiven Technologien für Ausbildung und Entscheidungsunterstützung. Mixed-Reality-Systeme wie das Bundeswehrprojekt ACOP könnten auch in NRW weiterentwickelt werden. - Quantentechnologien:
Die Startups eleQtron (Siegen) und Black Semiconductor (Aachen) arbeiten an Quantentechnologien mit Potenzial für sichere Kommunikation, Sensorik und Hochleistungsrechner. Die Landesregierung unterstützt diese Entwicklungen über „Quantum NRW“. - Cybersicherheit:
In Bochum (HGI) und Bonn (BSI, Bundeswehr) ist ein hochkompetentes Cyber-Cluster angesiedelt. Startups wie PHYSEC, XignSys oder secunet bieten Lösungen für sichere Kommunikation, Datenräume und kritische Infrastrukturen.
Viele Unternehmen und Hochschulen in NRW arbeiten an Hochtechnologien, die bisher rein zivil genutzt werden, aber ein hohes Verteidigungspotenzial besitzen:
- Industrie 4.0 und Logistik – Automatisierung, autonome Intralogistik, Wartungs-IT für militärische Fahrzeuge oder Lagerlogistik.
- MedTech und Sanitätswesen – tragbare Diagnostik, Notfallversorgung, KI-basierte Triage-Systeme.
- Geodaten und Raumfahrt – Nutzung von Satellitenbildern, Sensorfusion für militärische Lagebilder.
- Werkstoff- und Energietechnik – neue Materialien, mobile Energiesysteme, Schutztechnik.
Diese Akteure benötigen gezielte Programme, um Dual-Use- und Defense-Anwendungen zu identifizieren und marktnah zu entwickeln.
NRW im nationalen und europäischen Vergleich
- National:
Bayern hat mit München ein starkes DefenseTech-Zentrum aufgebaut (z. B. Helsing, Quantum Systems) und verfügt über gezielte Fördermechanismen. Berlin punktet mit dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr und hoher Startup-Dichte. NRW hat im Vergleich eine breitere, weniger spezialisierte Landschaft, aber große industrielle Tiefe und Forschungsdichte. - Europa:
Frankreich (Preligens, Definvest), die Niederlande (NATO-DIANA-Testzentren), Schweden (Saab Ventures) und Estland (Milrem Robotics, NATO-CCDCOE) zeigen, wie gezielte Strategie, öffentliche Förderung und offene Innovationskultur ein DefenceTech-Ökosystem erfolgreich machen können.
SWOT-Analyse für NRW
| Stärken | Exzellente Forschungslandschaft (KI, Quanten, Cyber), starke Industrie (Hidden Champions), führender Cyber-Cluster (Bochum/Bonn), zentrale Lage mit NATO-Nähe. |
|---|---|
| Schwächen | Geringe Sichtbarkeit als DefenseTech-Standort, fragmentierte Struktur, zaghafte Startup-Kultur im Verteidigungsbereich, Zivilklauseln an Hochschulen. |
| Chancen | Verteidigungsinvestitionen, EU-Förderprogramme (EDF, DIANA), wachsender Bedarf an Dual-Use-Technologien, wachsendes Sicherheitsbewusstsein. |
| Risiken | Abwanderung von Talenten, politische Wechselstimmung, Beschaffungsbürokratie, fehlende frühzeitige Orientierung von Gründern Richtung Defence. |
Handlungsempfehlungen für NRW
- Förder- und Anreizsysteme ausbauen
- Aufbau eines landeseigenen Förderprogramms für Dual-Use-Projekte.
- Zuschüsse für Prototyping und Demonstratoren (TRL 4–6).
- Zugang zu Bundeswehr-Testumgebungen und strategischen Bedarfsträgern.
- DefenceTech sichtbar machen
- Jährlicher Fachkongress „DefenseTech.NRW“ als Flagship-Event.
- Meetups und Themenformate in bestehenden Clustern (z. B. Cybersecurity Cluster Bonn).
- Repräsentanz auf Sicherheitsmessen (ILA, Eurosatory, MSK).
- Hochschulen gezielt einbinden
- Fellowships für sicherheitsrelevante Forschung.
- Dialogformate zu Zivilklauseln und Rüstungsakzeptanz.
- Entrepreneurship-Kurse mit Fokus auf Sicherheitstechnologien.
- Kompetenzzentren & Testfelder schaffen
- Dual-Use-Zentren an bestehenden Forschungseinrichtungen (z. B. Fraunhofer INT).
- Öffentliche Reallabore (z. B. autonome Logistik, 5G-Campusnetze).
- „DefenseTech Challenge NRW“ für schnelle Projektanbahnungen
Der neue DefenseTech-Inkubator.NRW – initiert von 1stMOVER, unterstützt von starken Partnern

Der DefenseTech-Inkubator.NRW ( www.defensetechinkubator.nrw) greift viele der zuvor genannten Handlungsempfehlungen auf und wird als zentrale Plattform für die Sensibilisierung, Aktivierung und Unterstützung von Startups, Hochschulteams und Spin-offs im Bereich DefenseTech etabliert. Ziel ist es, ein nachhaltiges Innovationsökosystem für Verteidigungstechnologien in Nordrhein-Westfalen aufzubauen, das durch enge Kooperationen zwischen Hochschulen, Startups, Unternehmen und der öffentlichen Hand gekennzeichnet ist.
Ein besonderer Fokus liegt darauf, Startups und akademische Teams, die bisher primär zivile Technologien entwickelt haben, für den DefenseTech-Sektor zu gewinnen und ihre Innovationspotenziale nutzbar zu machen. Viele technologische Durchbrüche in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Robotik, Sensorik oder Cybersecurity haben sowohl zivile als auch militärische Anwendungen. Der Inkubator hilft dabei, diese Potenziale gezielt für die Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie zu erschließen.
Der Inkubator nutzt bestehende Förderprogramme, Hochschulstrukturen und Unternehmensnetzwerke, um die Entwicklung und Markteinführung neuer DefenseTech-Lösungen zu beschleunigen und NRW als führenden Standort für Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien zu etablieren:
- Verbesserung des Technologietransfers von NRW-Hochschulen & Startups in DefenseTech-Anwendungen.
- Erhöhung der Gründungsaktivität im DefenseTech-Sektor in NRW mit 10–15 neuen DefenseTech-Startups in 3 Jahren.
- Essentieller Beitrag zum Aufbau eines DefenseTech-Innovation-Ökosystems in NRW und für die Sichtbarkeit von NRW als sicherheitsrelevanter Hightech-Standort.
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von NRW im deutschen und europäischen Verteidigungsmarkt.
Mit einem dedizierten DefenseTech-Inkubator kann NRW zu einem zentralen Akteur für Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie-Innovationen in Deutschland werden und dadurch die Entwicklung dieser wichtigen und sensiblen Industrie verantwortungsvoll mitgestalten - in einem offenen Dialog und mit klarem ethischen Kompass.
Der DefenseTech-Inkubator.NRW wird unterstützt von: